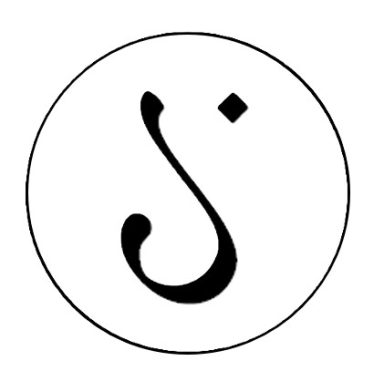Goldschmieden im Mittelalter
Das mittelalterliche Goldschmieden ist ein persönliches Interesse aus meinem Studium, das ich hier teilen möchte, und kein Teil meiner freiberuflichen Tätigkeit.
Meine Bachelorarbeit in der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie habe ich zu dem spezifischen Themenbereich „Das jüdische Goldschmiedehandwerk im Mittelalter“ verfasst. Bei Interesse kann die Arbeit hier gelesen werden:
Mittel- bis langfristig hoffe ich, mich zusätzlich zur normalen Goldschmiedetätigkeit mit „experimenteller Archäologie“ beschäftigen zu können – das heißt, ich möchte versuchen, mittelalterliche Goldschmiedetechniken unter historischen Bedingungen nachzustellen und auszuprobieren.
Einen Überblick und Ausschnitt dessen, was ich bisher zum historischen Goldschmiedeberuf gelesen und zusammengetragen habe, könnt ihr hier sehen.

Das Handwerk
Etwa ab dem 9. Jahrhundert entwickelte sich eine örtliche Gebundenheit von Goldschmieden in Klosterwerkstätten, insbesondere in der Romanik. Dort wurde kaum Schmuck, sondern hauptsächlich sakrales Gerät für den Gottesdienst hergestellt. Vereinzelt gab es Hofgoldschmiede, die speziell für adelige Würdenträger zu arbeiten hatten. Im 12. Jahrhundert erlebten die Städte eine massive Weiterentwicklung, mit der auch eine Konzentration des Handwerks dort einherging. Allmählich entstand die Handwerksorganisation in Zünften. Nun wurden zunehmend auch Schmuck und Ziergegenstände für die breite Adelsschicht und das wohlhabende Bürgertum hergestellt, besonders in der Gotik, in der auch architektonische Gestaltungelemente in den Schmuck eingearbeitet wurden. Für weniger wohlhabende Kunden wurde vermehrt auch mit vergoldetem Kupfer gearbeitet. Der Goldschmied fertigte nicht mehr nur auf Auftrag an, sondern auch auf Vorrat. In diesem Zuge gab es mehr Arbeitsteilung, damit eine Diversifizierung und Spezialisierung, sowie Serienproduktionen. Ab der Hochgotik (14. Jahrhundert) nahm der Anteil der Anfertigung von einfachem bürgerlichem Schmuck noch einmal deutlich zu.
Schmuck wurde von beiden Geschlechtern getragen. Weltlicher Schmuck konnte sowohl funktional sein, z.B. als Knopf, Brosche oder Gürtelschließe, oder aber lediglich dekorativ als Diadem, Reif, Ring, Siegel, Rosenkranz oder Collierkette getragen werden. Für Männer gab es außerdem militärischen Schmuck wie Schwert- oder Sporenverzierungen. An weltlichem mittelalterlichem Schmuck sind heute hauptsächlich Ringe und Broschen erhalten. Schmuck und Gerät für weltliche Verwendung wurden häufig wieder eingeschmolzen, um neuen Moden angepasste Stücke daraus zu fertigen.
Das zweite große Tätigkeitsfeld der Goldschmiede war das Anfertigen von sakralem Gerät wie Abendmahlsgeschirr, Vortragekreuzen, Reliquiaren oder Monstranzen. Solche Stücke sind bekannter als weltlicher Schmuck und werden vorwiegend mit mittelalterlicher Goldschmiedekunst assoziiert, da sie insgesamt zahlreicher und besser erhalten geblieben sind.
Beschreibende Schriftquellen über Techniken, Arbeitsweisen oder Werkstätten der Edelmetallverarbeitung sind hauptsächlich aus dem Hochmittelalter erhalten. Das bekannteste und wichtigste Werk stellt hier die „Schedula diversarum artium“ von Theophilus Presbyter dar, insbesondere der dritte Band über die Goldschmiedekunst. Die Identität des Autors, der unter Pseudonym schrieb, ist umstritten, die Authentizität und der Wert des außergewöhnlich detaillierten Buchs über verschiedene Techniken jedoch ohne Zweifel. Die deutsche Goldschmiedekoriphäe Erhard Brepohl gab dieses Werk übersetzt und mit eigenen Anmerkungen heraus.
Zünfte, Ausbildung und Stand in der Gesellschaft
Beginnend im 12. Jahrhundert, hauptsächlich jedoch im 13. und 14. Jh. entwickelte sich die Organisation des städtischen Handwerks in Zünften. Darüber wurden Ausbildungsstandards, Qualität der hergestellten Produkte sowie Produktions- und Verkaufsbedingungen zur Vermeidung von Konkurrenz und Betrug festgelegt. Die Zünfte hatten wenig politischen Einfluss in den Stadträten, das änderte sich erst im 14. und 15. Jahrhundert.
Um eine Lehre zum Goldschmied beginnen zu können, musste vielerorts der Nachweis einer „ehrlichen“ Abstammung erbracht werden, in manchen norddeutschen Städten wie Wismar, Hamburg oder Lübeck bedeutete dies auch den Nachweis der deutschen Abstammung.
Die Aufnahme als Lehrling erfolgte meist mit 14 oder 15 Jahren. Die Lehrzeit dauerte mindestens 4 Jahre. Nach dem Gesellenabschluss war lokal unterschiedlich eine verschieden lange Wanderschaft vorgeschrieben. Um 1400 setzte sich die Wanderschaft insbesondere in künstlerischen Berufen durch, an einzelnen Orten wurde sie schon ab dem 13. Jahrhundert praktiziert. Ab dem 15. Jahrhundert wurde sie weitgehend zur allgemeinen Pflicht.
Ebenso nach Ort und Zeit unterschiedlich waren die Bedingungen zur Meisterbewerbung. Bei der Annahme einer Bewerbung zum Meister wurden die geforderten Meisterstücke festgelegt. Wurde die Meisterprüfung bestanden, musste ein Meistergeld an die Zunft entrichtet werden. Besaß der neue Meister das Bürgerrecht einer Stadt, durfte er nun eine Werkstatt gründen und Lehrlinge ausbilden.
Um Betrug zu vermeiden, unterlag jede Werkstatt einer Kennzeichnungspflicht mit Meister- und Stadtzeichen als Garantie für den angegebenen Feingehalt eines Objektes, auch diese war in jeder Zeit und Stadt verschieden geregelt. Der Feingehalt wurde durch den Beschaumeister der Zunft überprüft, der bei Bestätigung der Angabe die Markierungszeichen einschlug und die Ware zum Verkauf freigab.
Goldschmiede hatten eine hohe Stellung in der Gesellschaft. Zu Beginn des Mittelalters repräsentierten ihre Werke Gott und/oder die Staatsmacht, auch im Laufe der Säkularisierung blieb ihre Arbeit den Reichen vorbehalten. Auch die Handwerker selbst mussten eine recht wohlhabende Ausgangsposition haben, um überhaupt das teure Grundmaterial beschaffen zu können. Der Goldschmied nahm sich ausdrücklich nicht nur als Handwerker, sondern auch als Künstler wahr. Man hatte ein „aristokratisches Standesbewusstsein“.
Frauen als Goldschmiedinnen
Wie bei anderen mittelalterlichen Gewerken waren Frauen in der Regel keine selbstständigen Handwerkerinnen und traten nie als solche auf, konnten als Ehefrau jedoch ggf. dem Meister zuarbeiten oder unter Umständen das Geschäft bei längerer Abwesenheit des Mannes oder nach Verwitwung zumindest für eine gewisse Zeitspanne annähernd selbstständig übernehmen. Auf vereinzelten Bildquellen sind Frauen in der Fertigung oder im Verkauf von Goldschmiedeprodukten zu sehen. Manche Frauen scheinen sich auf das Polieren spezialisiert zu haben, außerdem war die Tätigkeit der Goldspinnerei eine spezifisch weibliche Profession, die eigene Frauenzünfte bildete. In Köln ist die Goldschlägerin Maria Goltsleggera belegt, auch die als „Aurifabra“ (Goldschmiedin) bezeichnete Greta von Birboym ist in Schriftquellen genannt, möglichweise waren dies Fortführungen als Witwenbetriebe. In England ist aus 1497 sogar die Annahme zweier Lehrlinge durch eine Frau in der Goldschmiede dokumentiert, nachdem ihr Ehemann verstorben war.
St. Eligius
St. Eligius ist der Schutzpatron der Goldschmiede. Die historischen Informationen zu dieser Person besagen, dass er von 588-659 lebte. Er war Goldschmied am merowingischen Hof, erst für König Chlotar (584-622), später Dagobert (622-638). Er verließ den Hof und war von 639-641 Bischof von Tours, 632 gründete er das Kloster Solignac bei Limoges. 642 wurde er Bischof von Noyon (er ist auch als Eligius von Noyon bekannt).
Die Heiligenlegende besagt, dass seine Mutter in der Schwangerschaft eine Vision eines Adlers hatte, die auf die Geburt eines Heiligen hindeutete. Seine Eigenschaft als Schutzheiliger der Goldschmiede entstand, als Eligius den Auftrag erhielt, einen goldenen Thron für den König zu fertigen. Durch fachkundiges Legieren und geschickte Verarbeitung konnte er aus dem zur Verfügung stehenden Material zwei Throne fertigen. Eine weitere Legende erzählt, dass Eligius ein Pferd beschlagen habe, indem er dessen Bein abschnitt, den Huf beschlug und das Bein wieder ansetzte. Daher ist Eligius auch der Schutzheilige der Schmiede.
Seine Attribute sind Kelch, Hammer, Amboss, Zange oder Pferdefuß, sein Feiertag ist der 1. Dezember.
Aufgaben und Vergleich zum heutigen Beruf
Die Arbeit einer*s heutigen Goldschmied*in hat nicht mehr viel mit der des mittelalterlichen Goldschmieds zu tun. Zwar wird noch das gleiche Material verarbeitet, doch die Art der Verarbeitung sowie der Produkte haben sich stark gewandelt. Vor allem gibt es natürlich einen großen technischen Unterschied, vieles ist durch Maschinen oder moderne Technik möglich. Zum Beispiel kann mit der Gasflamme statt auf Kohlen gelötet werden oder das Material kann gewalzt, es muss nicht mehr ausgeschmiedet werden. Viele Techniken wie Ziselieren, Tauschieren oder traditionelles Emaillieren werden kaum noch nachgefragt und sterben allmählich aus.
Heute ist die Tätigkeit von Gold- und Silberschmied*in nicht (nur), wie die Bezeichnung vermuten lässt und es im Mittelalter der Fall war, durch die Verarbeitung des Hauptmaterials Gold oder Silber bestimmt. Nun ist das Fertigungsprofil auch mit den Objekten verknüpft, die hergestellt werden, diese Trennung der beiden Berufe entwickelte sich im 18. Jahrhundert. Beide machen Schmuck, jedoch ist das Schaffen von Gerät durch die Technik des Treibens nun eine Aufgabe der*s Silberschmieds*in. Hier wird jedoch noch relativ traditionell gearbeitet. Ein*e Goldschmied*in fertigt eher kleinere Objekte und meist ausschließlich Schmuck, häufig auch aus Silber. Die Bezeichnungsunterscheidung durch das Material ist heute also irreführend, die Abgrenzung der zwei Berufe findet über die Art ihrer Produkte statt. Möglich sind trotzdem kombinierte Werkstätten, die beides anbieten, sofern der*die Handwerker*innen es gelernt haben.
Literaturempfehlungen
Für alle, die sich gerne detaillierter mit dem mittelalterlichen Goldschmieden beschäftigen möchten, habe ich eine Literaturauswahl zusammengestellt, aus der zum Teil auch die obenstehenden Informationen stammen (wer einen wissenschaftlichen Nachweis zu einzelnen Abschnitten im Text benötigt, melde sich gerne bei mir). Die wichtigsten sind markiert. Sollte jemand auf der Suche nach Informationen zu spezifischen Themenbereichen sein, kontaktiert mich ebenfalls gern.
E. Brepohl, Theophilus Presbyter und die mittelalterliche Goldschmiedekunst (Leipzig 1987).
J. Cherry, Medieval goldsmiths (London 2011).
V. H. Elbern, Die Goldschmiedekunst im frühen Mittelalter (Darmstadt 1988).
H. Roth, Kunst und Handwerk im frühen Mittelalter. Archäologische Zeugnisse von Childerich I. bis zu Karl dem Großen (Stuttgart 1986).
E. Vavra, Ich Goldtschmid mach köstliche ding. Organisation - Arbeitsbedingungen - Produkte. Das Mittelalter 21, 2016, 273–294.
J. Wolters, Written Sources on the History of Goldsmithing Techniques from the Beginnings to the End of the 12th Century. Jewellery Studies 11, 2008, 46–66.